Der Bildungsausschuss des Landtags hatte für den 5. November 2025 zu einer Anhörung zu einem Antrag der Fraktion Die Linke eingeladen. Fachleute waren um Statements zum Thema „Gedenkstättenfahrten verbindlich machen“ gebeten worden. Die AfD-Fraktion hatte vor Beginn der Anhörung die Ausschusssitzung „aus Protest“ verlassen, da ihr gewünschter Sachverständiger vom Ausschuss nicht zugelassen worden war. (siehe Textende)
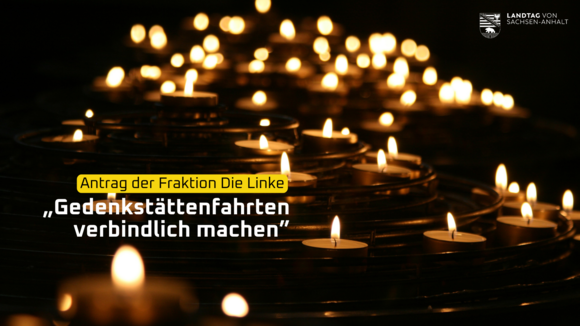
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sei nicht nur ein historischer Rückblick,
sondern eine politische und gesellschaftliche Verpflichtung, konstatiert die Fraktion Die Linke in ihrem Antrag (Drs. 8/5547). Durch diesen soll die Landesregierung u. a. sicherstellen, dass jede Schülerin und jeder Schüler an allgemeinbildenden Schulen bis zum Ende der Sekundarstufe I an einer Gedenkstättenfahrt teilnimmt und die pädagogische Qualität und die strukturelle Umsetzung der Gedenkstättenfahrten weiterentwickelt und gesichert werden. Der Antrag war im Juni 2025 in den Ausschuss für Bildung überwiesen worden. In seiner 52. Sitzung hatte sich der Ausschuss zu einer Anhörung verständigt.
Wortmeldungen aus der Anhörung
In Sachsen-Anhalt seien im Jahr 2025 209 Gedenkstättenfahrten von 135 Schulen organisiert worden, sagte Maik Reichel von der Landeszentrale für politische Bildung. Es gebe eine Vollfinanzierung der Fahrtkosten mit Bahn und Bus in die Gedenkstätten Sachsen-Anhalts. Die Schulen würden bei der Vor- und Nachbereitung unterstützt. Fahrten nach außerhalb von Sachsen-Anhalt würden anteilsmäßig mit 60 Prozent der Kosten unterstützt. All diese Fahrten seien freiwillig, nicht verpflichtend gewesen. Die durchschnittlichen Fahrtkosten betrügen 450 Euro. Dadurch seien 2025 128 400 Euro ausgegeben worden. Das Budget von 125 000 Euro sei durch Umwidmung bereits ergänzt worden, um die Kontinuität der Fahrten nicht abbrechen zu lassen. Reichel gab zweierlei zu bedenken: Machte man die Gedenkstättenfahrten verpflichtend, müssten 637 Schulen des Landes eingebunden und Kosten von rund 600 000 Euro eingeplant werden. In der Landeszentrale für politische Bildung bräuchte man mindestens drei Stellen, die sich um die ganze Planung kümmerten. Schon jetzt seien die Buskapazitäten so gering, dass manche Schulen schon froh seien, wenn sie ein einzelnes Angebot einholen könnten.
Gedenkstättenfahrten lieferten einen großen gesellschaftlichen Ertrag, konstatierte Prof. Dr. Christian Kuchler vom Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte an der Universität Augsburg. Sie lieferten eine Bestätigung des in der Schule Gelernten und der Tatsächlichkeit des historisch Geschehenen, man erfahre die zusätzliche Dimension des Ortes, erhalte eine emotionale Ergänzung zum schulischen Lernen, der historische Ort werde zum Lernort. Vor- und Nachbereitung seien essenziell, die Fahrten sollten auf jeden Fall in den Geschichtsunterricht eingebunden werden, betonte Kuchler. Die Grundidee des Antrags könne er unterstützen, die Orte der SED-Diktatur sollten aber unbedingt miteinbezogen werden. Mehrtägige Fahrten hätten einen noch größeren Ertrag, „die Vertiefung mit dem Thema ist eine ganz andere“. Alle Schülerinnen und Schüler sollten definitiv eine Gedenkstätte besuchen, aber ob das mit einem verpflichtenden Charakter besser funktioniere, müsse evaluiert werden.
Der gesetzliche Auftrag der Stiftung ergebe sich aus der historischen Verantwortung des Landes, erklärte Dr. Kai Langer von der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt. Gedenkstätten seien frühere Tatorte, wo sich Menschenrechtsverletzungen ereignet hätten, sie seien heute moderne Lernorte mit unterschiedlichen pädagogischen Angeboten. „Die Inhalte sind nicht allgemein, sondern sie sind konkret auf den historischen Ort bezogen“, so Langer. Es gebe Konsens darüber, dass es keine Relativierung der NS-Verbrechen und keine Verharmlosung der SED-Verbrechen geben dürfe. Der nun behandelte Antrag zeige eine große Wertschätzung der Arbeit der Gedenkstätten. „Sie sind aber keine Läuterungsanstalten“, manifestierte Weltanschauungen könnten hier ebenso wenig aufgebrochen wie unbedarfte Jugendliche gegen solche Weltanschauungen imprägniert werden. Wenn bei den jungen Menschen etwas hängenbleiben solle, empfählen sich Projekttage. Langer sprach sich gegen Pflichtbesuche aus, unter anderem wegen der personellen und örtlichen Mindestausstattung in den Einrichtungen. Die Zahl der pädagogischen Kräfte sollte – auch abseits von Pflichtbesuchen ‒ auf je zwei angehoben werden.
„Erinnerungskultur ist nicht nur Geschichte, sondern Teil unserer Gegenwart und Zukunft“, erklärte Lucienne Balke vom Landesschülerrat Sachsen-Anhalt. Gedenkstättenfahren sollten nach Ansicht der Schülervertretenden verpflichtend werden; insbesondere vor dem Hintergrund des Erstarkens von Rechtsextremismus sei es wichtig, sich aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Schulen sollten allerdings dazu verpflichtet werden, die Gedenkstättenbesuche pädagogisch einzubetten. Eine Gedenkstättenfahrt sei genauso grundlegend wie jedes anderes Fach, sie schaffe nicht nur Wissen, sondern auch Haltung, so Balke. Die Schülervertretung spricht sich dafür aus, dass das Land die Kosten vollständig übernehmen solle, damit wirklich alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen könnten. Die Gedenkstätten seien Orte des Lernens, aber auch Orte des Fühlens, hier lerne man viel über Menschlichkeit, Respekt und Demokratie.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte funktioniere in Sachsen-Anhalt nicht, ohne beide Diktaturen in den Fokus zu nehmen, betonte Johannes Beleites, Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt. Mit Zwang erreiche man nicht unbedingt das, was man erreichen wolle, so Beleites, eine „Verpflichtung ist nicht zielführend“, das habe man aus der Handhabung solcher Gedenkstättenfahrten zu DDR-Zeiten lernen können. Das Thema sei zu wichtig, es dürfe nicht zum Ping-Pong-Spiel zwischen den politischen Kräften im Land werden, mahnte der Landesbeauftragte.
Der Ausschuss für Bildung wird nun eine Beschlussempfehlung zum Antrag erarbeiten, die dem Landtag zur Abstimmung vorgelegt werden soll.
Hintergrund: Ausschuss lehnte Wunsch-Gast ab
Götz Kubitschek sollte Sachverständiger der AfD-Fraktion werden, dies aber hatte die Mehrheit des Bildungsausschusses im Vorfeld abgelehnt. Der Antrag auf Anhörung von Kubitschek wurde mit zehn Nein- und drei Ja-Stimmen am Sitzungsbeginn am 5. November 2025 erneut abgelehnt. Der Ausschuss habe der AfD ihr grundlegendes demokratisches Beteiligungsrecht verweigert, deswegen werde seine Fraktion nicht an der Anhörung „Gedenkstättenfahrten verbindlich machen ‒ Erinnerungskultur als demokratische Bildungsaufgabe stärken“ teilnehmen, erklärte der AfD-Abgeordnete Dr. Hans-Thomas Tillschneider. Die AfD verlasse „aus Protest“ die Sitzung des Bildungsausschusses. Die AfD-Fraktion hätte, so Ausschussvorsitzender Stephen Gerhard Stehli (CDU), die Möglichkeit gehabt, einen anderen Sachverständigen zu benennen. Dies habe sie nicht gewollt.

